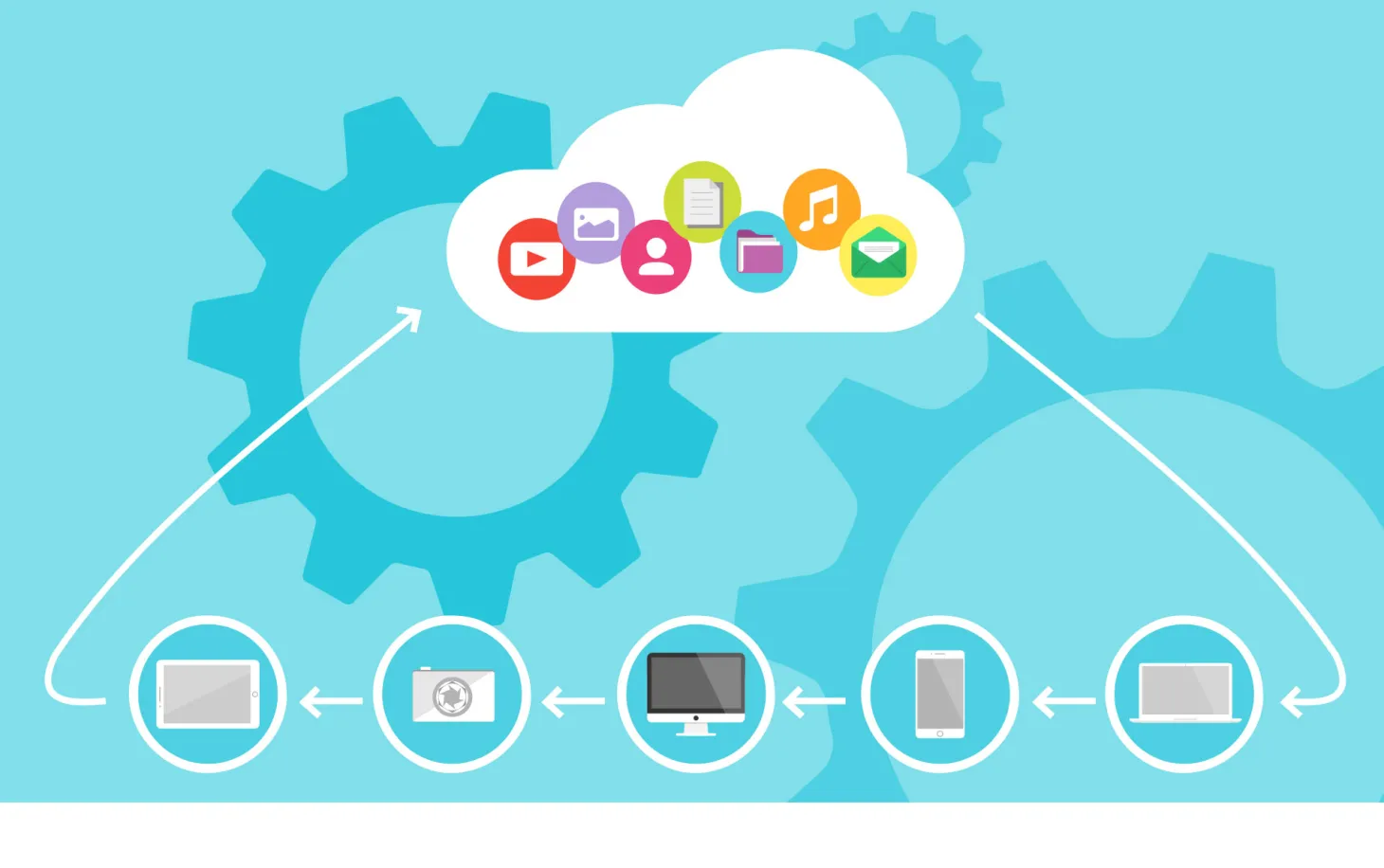Kleingewerbe anmelden – so gehts


Mit seinem Hobby nebenher Geld dazuzuverdienen ist wohl der Traum vieler Arbeitnehmer. Gerade junge Menschen sehnen sich auch neben der Ausbildung nach einem kleinen Extragehalt. Viele finden die Lösung in einem Kleingewerbe. Doch was ist das überhaupt? Wie kann ich ein Kleingewerbe anmelden? Worauf muss man als achten und lassen sich eine parallele Ausbildung und Kleingewerbe miteinander verbinden? Folgend alle wichtigen Fakten.
Was ist überhaupt ein Kleingewerbe?
Wenn Sie alleine gründen, aber sich nicht als Kaufmann ins Handelsregister eintragen lassen wollen, führt Sie Ihr Weg über ein sogenanntes Kleingewerbe. Anders als der Name verlauten lässt, handelt es sich hierbei jedoch nicht um ein richtiges Gewerbe im engeren Sinn, sondern drückt viel mehr eine Unterform von geringerem Umfang aus. Das sogenannte Kleingewerbe kann z.B. als Zusatzverdienst von Angestellten, Hausfrauen und auch Studenten in Anspruch genommen werden. Somit entfällt die gewerbliche Pflicht einer Buchführung oder einer abschließenden Bilanz. Das hält den bürokratischen Aufwand für ein Kleingewerbe in Grenzen.
Welche Regeln setzt ein Kleingewerbe?
Wer finanzielle Mittel erwirtschaftet, der muss sich je nach Art und Weise der Tätigkeit und seines Berufstandes an einige Regeln halten. Auch das Kleingewerbe setzt einige Bedingungen voraus und bezieht seine ganz eigenen Voraussetzungen und Möglichkeiten für den Kleinunternehmer.
- Das Startkapital
Gut, so richtig passt diese Überschrift vielleicht nicht, denn wenn Sie ein Kleingewerbe anmelden, ist kein Startkapital von Nöten. Dafür bleibt es Ihnen selbst überlassen, wie viel Geld Sie in Ihr Kleinunternehmen einfließen lassen. Im Endeffekt haften Sie hierbei mit Ihrem Privatvermögen. - Kleinunternehmerregelung nach 19 UStG
Diese Regelung spart Zeit und erleichtert Ihnen die Buchführen – eignet sich jedoch nur bis zu einem bestimmten Einkommen und regelt die Versteuerung wie folgt:- Die Kleinunternehmerregelung gilt für fünf Jahre, sofern einige Richtwerte beachtet werden. So darf der Kleinunternehmer (nach seinem Schätzwert) im ersten Jahr nicht über 17.500 Euro erwirtschaften.
- Wächst das Unternehmen, wird die Regelung aber nicht automatisch hinfällig. Bis zu 50.000 Euro dürfen Sie im Folgejahr erreichen. Liegen Ihre Einnahmen höher, ist die Kleinunternehmerregelung ungültig und die Umsatzsteueraufhebung nichtig
- Die Umsatzsteuererklärung
Greift die Kleinunternehmensregelung in Ihrem Kleingewerbe, müssen Sie dem Finanzamt keine Umsatzsteuerzahlungen leisten. Zwar sind Sie verpflichtet, eine Umsatzsteuer-Erklärung abzugeben, beantworten dort jedoch nur die für Sie maßgeblichen Fragen.
Zusammengefasst gelten Sie als Kleinunternehmen wenn Sie jährlich nicht mehr als 17.500 Euro Umsatz erwirtschaften. Genaueres zur Kleinunternehmerregelung können Sie hier nachlesen. - Die Umsatz- und Einkommenssteuer
Wenn Sie für Ihr Kleingewerbe eine Rechnung schreiben, weisen Sie keine Umsatzsteuer aus – da Sie diese vom Kunden auch nicht kassieren. Besteuert werden Sie als Kleinunternehmer durch die Einkommenssteuer (Ausnahmen bilden Studenten, welche nicht besteuert werden). - Ein Vorsteuerabzug
Sollte Sie eine Einnahmen-Überschussrechnung tätigen müssen, können Sie keinen Vorsteuerabzug geltend machen.
Wie melden Sie ein Kleingewerbe an?
Wenn Sie ein Kleingewerbe anmelden, gründen Sie nicht etwa eine Firma mit eigenem Logo und Slogan, sondern firmieren mit Ihrem Vor- und Nachnamen. Folgende Punkte sollten Sie beachten, wenn Sie sich dazu entschließen, ins Kleingewerbe einzusteigen:
- Wie jedes andere Gewerbe auch, melden Sie Ihr Kleingewerbe über das Gewerbeamt an Ihrem Wohnort an.
- Die einmalige Anmeldegebühr des Kleingewerbes kostet Sie zwischen 30-50 Euro je nach Kommune.
- Nachträglich erhält das Finanzamt einen Durchschlag von der Anmeldung und sendet Ihnen entsprechende Formulare zur Geschäftseröffnung zu.
- Sollten Sie Freiberufler sein, fallen Sie nicht unter die Kategorie Kleingewerbe und Handelsgewerbe und müssen sich weder beim Gewerbeamt noch Handelsregister eintragen lassen.
Freiberufler sind auf bestimmte Berufsgruppen und werden unter anderem steuerlich anders behandelt. Welche Berufsgruppen als Freiberufler gelten können Sie hier detaillierter nachlesen.
Wie vereinen Sie Kleingewerbe und Ausbildung?
Gerade Azubis gehören nicht gerade zu den Großverdienern in den jeweiligen Branchen – ein Glück, dass die deutsche Gesetzgebung keine speziellen Nebenjob-Regelungen für Auszubildende vorgibt. Entscheidend hierbei ist vielmehr das Alter – wer unter 18 Jahren eine Nebentätigkeit ausübt, bei dem greift das Jugendschutzgesetz und nicht das deutlich flexiblere Arbeitsschutzgesetzt. Grundsätzlich sind Nebentätigkeiten somit erlaubt, sofern Ihr Ausbildungsvertrag nichts anderes sagt und folgende Punkte sich nicht auf Sie ausüben:
- Ihr Ausbildungserfolg oder die Erledigung Ihres Berufsalltags ist gefährdet, da sich Ihre Nebentätigkeit negativ auf Ihre Leistungsfähigkeiten ausübt.
- Ihre Nebentätigkeit wird bei der Konkurrenz ausgeführt. Hier gilt das sogenannte „Wettbewerbsverbot“, demzufolge Volljährige nicht in konkurrierenden Firmen arbeiten dürfen.
Wie viel Sie mit Ihrer Nebentätigkeit neben der Ausbildung verdienen dürfen, hängt unter anderem von dem Stundenbedarf ab, den Sie im Ausbildungsberuf leisten. Hierbei ist es Minderjährigen untersagt, täglich länger als acht Stunden und wöchentlich mehr als 40 Stunden zu arbeiten, während Volljährige mit einem Pensum von bis zu 48 Stunden in der Woche und sechs Wochentagen rechnen dürfen. Doch auch hier gilt: Es gibt Ausnahmen – wie zum Beispiel beim Kleingewerbe, da hierbei die Stundenanzahl anders erfasst und ausgelegt wird.
Ausbildung und Kleingewerbe unter einen Hut zu bringen, kann den Alltag ganz schön unter zeitlichen Druck stellen. Damit Sie Ihrem Kleingewerbe nachgehen und gleichzeitig ihren Ausbildungsberuf mit gutem Gewissen ausführen können, gibt es Websites wie Kiehl, welche Ihnen wertvolles Wissen und Ausbildungsmaterial vermitteln, damit Sie als Azubi eine gute Figur machen. Wer eine Nebentätigkeit als Zusatzverdienst in Betracht zieht, dem werden von Rechtlagen her kaum Steine in den Weg gelegt. Harte Arbeit zahlt sich aus – im wahrsten Sinne des Wortes.
Rechtlicher Hinweis
Die Inhalte unserer Internetseite – vor allem die Rechtsbeiträge – recherchieren wir mit größter Sorgfalt. Dennoch können wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereit gestellten Informationen übernehmen. Die Informationen sind insbesondere auch allgemeiner Art und stellen keine Rechtsberatung im Einzelfall dar. Zur Lösung von konkreten Rechtsfällen konsultieren Sie bitte unbedingt einen Rechtsanwalt.
Häufige Fragen
Was ist Zeiterfassung für Kleinbetriebe?

Zeiterfassung für Kleinbetriebe bedeutet, Arbeitszeiten digital zu erfassen – inklusive Beginn, Ende und Pausen. Mit einer Software wie Crewmeister ersetzen KMU Zettel oder Excel durch eine einfache, rechtssichere Lösung.
Können Mitarbeiter ihre Zeiten mobil erfassen?

Ja. Mit Crewmeister erfassen Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten bequem per Smartphone, Tablet oder PC – im Büro, unterwegs oder direkt auf der Baustelle.
Wie einfach ist die Einführung der mobilen Zeiterfassung App?

Sehr einfach:
- Kostenlos registrieren
- Zeiterfassung App für iOS oder Android herunterladen
- Mitarbeitende einladen und direkt starten
Eine aufwändige Installation oder technische Einrichtung ist nicht erforderlich.